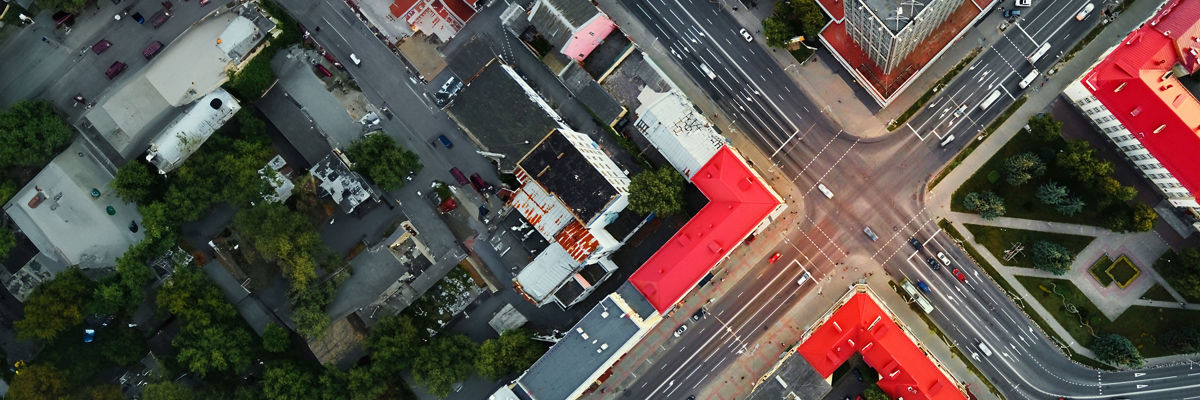
Paradigmenwechsel, aber die Liquidität bleibt
AUTOR
Robert M. Almeida
Portfoliomanager und
Global Investment Strategist
Im Überblick
- Staat und Notenbanken fällt es meist schwer, eine zu hohe Liquidität wieder einzufangen.
- Jetzt beginnt eine neue Zeit mit mehr produktiven Investitionen anstelle einer reinen Finanzmarktorientierung.
- Das kann Auswirkungen auf die Unternehmensgewinne haben. Aktive Manager können davon profitieren.
Jeder weiß, wie hoch die USA verschuldet sind. Und doch scheinen viele Anleger die wirtschaftlichen Folgen zu unterschätzen. Die Abbildung zeigt die langfristige Entwicklung von Staatsschulden und BIP in den USA. Auffällig, aber nicht überraschend, ist die Entkopplung seit der internationalen Finanzkrise 2008.
Was wir in den USA zurzeit erleben, ist nicht wirklich neu – und die Geschichte zeigt uns, wohin das führen kann. Dennoch scheinen mir viele Anleger zu optimistisch, wenn sie auf eine nachlassende Liquidität hoffen und glauben, dass das Ungleichgewicht dann verschwindet. Ich rechne mit etwas anderem. Was ich prognostiziere, verursacht Kosten. Es könnte aber dazu führen, dass Anleger aktives Management endlich wieder wertschätzen.
Schon oft ließen Regierungen die Geldmenge aus dem Ruder laufen
Seit Jahrhunderten neigen Regierungen dazu, Geld zu drucken, um diverse Projekte zu finanzieren. Die Methoden sind verschieden, die Folgen für Wirtschaft und Finanzmärkte aber offensichtlich. Auf zwei von vielen Beispielen möchte ich näher eingehen: auf eines aus dem alten Rom und eines aus dem England des 16. Jahrhunderts.
Um Kriege zu finanzieren, wurde der Silbergehalt des römischen Denars von etwa 200 v. Chr. bis 265 n. Chr. sukzessive verringert, von 100% auf 1%. Es kam zu einer Hyperinflation, die ihren Teil zum Untergang des Römischen Reiches beigetragen hat.
Viele Jahrhunderte später, im England des 16. Jahrhunderts, ordnete Heinrich VIII. an, den Edelmetallgehalt von Gold- und Silbermünzen zu verringern, ebenfalls zur Finanzierung teurer Kriege. In den 1540ern begann „die große Münzverschlechterung“: Edelmetalle wurden durch billigeres Kupfer ersetzt. Die Folgen? Hohe Inflation, Reputationsschäden bei den Handelspartnern und eine jahrelange Wirtschaftskrise.
Seit 2008 erhöhen die USA die Geldmenge auf andere Art: durch Quantitative Easing (QE). Selbst die niedrigsten Zinsen seit fast 5.000 Jahren reichten nicht, um das Wirtschaftswachstum zu fördern. Die Fed kaufte daher in großem Umfang Staatsanleihen und Mortgage-Backed Securities am freien Markt. Sie baute Wertpapierbestände auf und erhöhte die Geldmenge.
Wie aber die Abbildung oben zeigt, führt Quantitative Easing nicht immer zu Wachstum und Inflation. Eine Geldentwertung, ob durch einen geringeren Silbergehalt in Münzen oder den Aufbau unproduktiver Wertpapierbestände, führt zu einem Ungleichgewicht mit zu hohen Schulden.
Das ist deshalb ein so wichtiger Punkt, weil die Fed die Geldmenge nicht ohne Weiteres wieder verringern kann, um das Ungleichgewicht zu beseitigen. Es heißt, das Geldmengenwachstum müsse dem BIP-Wachstum entsprechen. Tatsächlich muss es aber dem Anstieg der Verschuldung entsprechen. Nur wenn die Wirtschaft so stark wächst, dass die Schulden bedient werden können, entsteht Überschussliquidität. Nur dann wird eine Schuldenkrise vermieden.
Was wahrscheinlicher ist
Nicht nur Cäsaren, Könige und Notenbanken schöpfen Geld. In unserem Teilreservesystem können das auch Geschäftsbanken. In der Neuzeit wurde Geld bis zur Finanzkrise meist so geschaffen. Lassen Sie mich kurz rekapitulieren, wie es funktioniert:
Wenn Banken einen Teil ihrer Sichteinlagen ausleihen, wird ein Schuldschein erstellt. Eine Forderung entsteht. Damit wird eine Verbindlichkeit beglichen, sodass Geld geschöpft wird.
Nimmt ein Kunde beispielsweise einen Kredit über 100 US-Dollar auf, unterzeichnet er einen Kreditvertrag bzw. Schuldschein. Damit verpflichtet er sich zur Rückzahlung. Für die Bank entsteht dadurch ein Aktivum in Höhe von 100 US-Dollar. Gleichzeitig schreibt die Bank dem Kreditnehmer den Kreditbetrag auf seinem Konto gut. Damit entsteht auf der Passivseite eine neue Einlage über 100 US-Dollar. Der Schuldschein bleibt als Forderung auf der Aktivseite bestehen, während auf der Passivseite an die Stelle der ursprünglichen Kreditverbindlichkeit nun die Einlage tritt. Diese Einlage ist neues Giralgeld, das es zuvor nicht gab.
Moderne Volkswirtschaften waren auf die Geldschöpfung der Geschäftsbanken angewiesen. Die Banken wiederum erzielten Gewinne und förderten das Wirtschaftswachstum. Doch als Wachstum nach der Finanzkrise 2008 dringend nötig war, geriet es ins Stocken. Das Quantitative Easing in den USA sollte die Konjunktur wieder ans Laufen bringen. Aber es lieferte nicht das gewünschte Ergebnis, denn die neu geschaffene Liquidität floss an den Finanzmarkt – durch Aktienrückkäufe, höhere Dividenden sowie Fusionen und Übernahmen.
Seit 2022 schöpfen die Geschäftsbanken aber wieder Geld. Sie finanzieren Investitionen in die Neuausrichtung der Lieferketten, die Digitalwirtschaft und besonders die KI-Infrastruktur. All das kann wirtschaftlichen Nutzen haben – anders als frühere Projekte, die in der Rückschau vor allem als Vermögenstransfer von Sparern zu Kreditnehmern erscheinen. Von 2009 bis 2021 wurden vor allem die Eigentümer von Finanzaktiva reicher.
Die Rahmenbedingungen können sich ändern, doch rechnen wir künftig mit einem höheren Wachstum als in den schwachen 2010ern. Inflation und langfristige Kreditzinsen dürften aber ähnlich hoch bleiben wie heute.
Die US-Staatsverschuldung dürfte nicht so bald fallen, auch wenn das Wirtschaftswachstum sicher eine Rolle spielt. Der Fed wird es daher künftig wesentlich schwererfallen, mit einer lockereren Geldpolitik Wirtschaft oder Märkte zu stützen.
Fazit
Früher wie heute haben Staaten Geld geschaffen. Die Vergangenheit zeigt uns, dass die einmal in den Umlauf gebrachte Liquidität nur schwer wieder zurückzuholen ist – denn keine Regierung will ihre Bürger mit Ausgabenkürzungen enttäuschen. Ohne Austeritätsprogramm müssen die Notenbanken aber an ihren aufgeblähten Bilanzen festhalten, um die übermäßige Verschuldung zu finanzieren.
Die Liquidität dürfte also bleiben. Aber jetzt hat ein neuer Kapitalzyklus begonnen, in dem die Ausrüstungsinvestitionen wieder steigen. Der Kapitalzyklus könnte frühzeitig enden – und vielleicht reicht er auch nicht, um die Verschuldung zu verringern. Dennoch glaube ich, dass Unternehmer wie Investoren künftig mit drei Entwicklungen zu tun haben, die es bis zu den 2010ern nicht gab:
- Die Fed könnte die Leitzinsen senken, aber die Langfristrenditen werden aufgrund der wieder stärkeren Konjunktur wohl auf dem derzeitigen Niveau verbleiben. Insbesondere rechne ich nicht mit einem deutlichen Rückgang der Zehnjahresrendite. Sie könnte sogar steigen.
- Unternehmen haben heute wesentlich höhere Kosten, und dabei wird es auch bleiben. Außer dem Kapital sind auch die Vorleistungen wesentlich teurer geworden, wegen der Politik und der stärkeren Konjunktur. Zugleich ist der Wettbewerb durch neue Technologien enorm gestiegen. Alteingesessene Firmen geraten in vielen Sektoren unter Druck und müssen mehr Geld für Produktinnovationen und besseren Kundenservice ausgeben.
- Wir glauben, dass Unternehmen aufgrund der ersten beiden Punkte nicht mehr so leicht Gewinne erzielen können. Dadurch werden die Unternehmensgewinne innerhalb der Sektoren und Branchen vermutlich stärker streuen. Wer etwas produziert oder anbietet, das die Kunden wirklich brauchen, kann bei steigenden Faktorkosten die Preise erhöhen und wird auch in Zukunft Erfolg haben. Wer es aber nicht kann, wird die zurzeit hohen Gewinnerwartungen enttäuschen, vor allem, wenn das alte Sicherheitsnetz aus künstlich niedrigen Zinsen und billigen Arbeitskräften entfällt.
Ich rechne daher mit einem neuen Paradigma, in dem die Einzelwertauswahl endlich wieder wichtig ist.
Der MSCI EAFE (Europe, Australasia, Far East) Index (Net Div.) ist ein kapitalisierungsgewichteter Index, der die Wertentwicklung von Industrieländeraktien ohne die USA und Kanada misst.
Der Standard & Poor’s 500 Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index aus 500 wichtigen US-Aktien, der die Entwicklung des amerikanischen Aktienmarktes abbilden soll.
Quelle der Indexdaten: MSCI. MSCI gibt keinerlei Garantien oder Gewährleistungen und übernimmt keinerlei Verantwortung für die hierin enthaltenen MSCI-Daten. Die MSCI-Daten dürfen weder weitergegeben noch als Grundlage für andere Indizes, Wertpapiere oder Finanzprodukte genutzt werden. Dieses Dokument wurde von MSCI weder erstellt noch genehmigt oder geprüft.
Standard & Poor’s® und S&P® sind eingetragene Handelsmarken von Standard & Poor’s Financial Services LLC (S&P); Dow Jones ist eine eingetragene Handelsmarke von Dow Jones Trademark Holdings LLC (Dow Jones). S&P Dow Jones Indices LLC hat ihre Nutzung genehmigt, und die Massachusetts Financial Services Company (MFS) darf sie zu bestimmten Zwecken nutzen. Der S&P 500® ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC. Das Unternehmen hat MFS die Nutzung des Index genehmigt. Die Produkte von MFS werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P oder ihren Tochterunternehmen nicht gefördert, angeboten, vertrieben oder beworben. Weder S&P Dow Jones Indices LLC noch Dow Jones, S&P oder ihre Tochterunternehmen treffen eine Aussage darüber, ob diese Produkte empfehlenswert sind.
Die hier dargestellten Meinungen sind die des Autors/der Autoren und können sich jederzeit ändern. Sie dienen ausschließlich Informationszwecken und dürfen nicht als Empfehlung zum Kauf von Wertpapieren, Aufforderung oder als Anlageberatung verstanden werden. Prognosen sind keine Garantien. Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse.